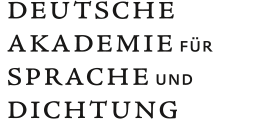»Widerstand. The Art of Resistance«
»Schlechte Gedichte/ bekehren den Despoten nicht./Das gilt, leider, auch für die guten Gedichte.«
Richard Krynicki
Ovid, Urvater aller späteren literarischen Exilanten, sah sein geliebtes Rom nicht wieder und starb unglücklich in der Verbannung am Schwarzen Meer. Wir aber, Leser seiner Metamorphosen, glauben gern ihren abschließenden Zeilen, in denen Ovid erklärt, dass sein vollbrachtes Werk weder von Feuer, Schwert noch Alter zerstört werden könne, es alles überdauern werde, auch Jupiters Zorn. Und mag es auch wahr sein, dass Ovid, sein eigenes Schicksal betreffend, keinen Widerstand gegen den Mächtigen seiner Zeit, Kaiser Augustus, zu leisten vermochte, so läuft doch nach wie vor die Wette, ob sich nicht die Metamorphosen letztlich als widerständiger als die Taten des römischen Jupiter, Augustus also, erweisen könnten.
Drei Bedeutungen hat das Wort „Resistenz“: Es bezeichnet den Härtegrad eines Gegenstands, sodann die Widerstandsfähigkeit eines Lebewesens gegenüber Einwirkungen von außen, schließlich den Widerstand gegen eine Lage, einen Menschen, eine Gruppe von Menschen. Alle drei Bedeutungen lassen sich ohne weiteres auf das Gedicht übertragen, das gefestigt genug sein will, um dem Vergehen zu trotzen, das mit dieser störrischen Beharrlichkeit und seiner Außerzeitlichkeit (oder Antiquiertheit, wie seine Verächter sagen würden) nachgerade immun zu sein scheint gegen den flüchtigen Zeitgeist und alle modischen Ismen – und das schließlich immer auch Gegenentwurf zum Status quo sein konnte und wollte, ein Widerspruch, ein Widerspinst. Wirklich, man darf das Thema dieser Poetica, Widerstand, durchaus im Plural lesen: Widerstände.
Dass die Poesie sich stets die Freiheit nimmt, Dinge anders zu sehen und zu fassen, Unmögliches zu versuchen, dass ein Gedicht also eine Kapsel voller Freiheit ist und seine Leser einlädt, es ihm gleich zu tun und die Welt anders zu denken, haben Autokraten ihm immer schon übelgenommen. Eine Zumutung im besten Sinne ist jedes gelungene Gedicht. Aber: Gibt es Zeiten (und sind dies unsere Zeiten?), in denen die Sprache des Gedichts eindeutiger, in denen es unmissverständliche Gegenrede werden muss, Kritik der Zustände? Liefe es bei der Berührung mit der Tagespolitik Gefahr, selbst mit dem Tag zu vergehen? Und auf welche Fahne – die knatternde auf den Barrikaden oder die trotzig gehisste auf der einsamen Insel – würde die herrliche Zeile Peter Rühmkorfs geschrieben: „Bleib erschütterbar und widersteh“?
- Jan Wagner
—